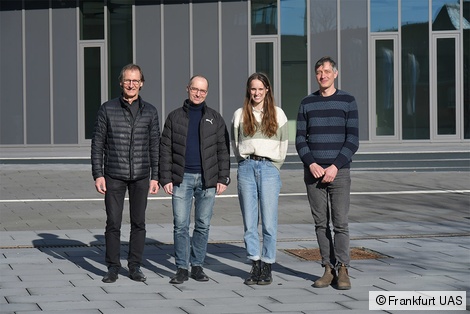Seit September ist die amerikanische Fulbright-Stipendiatin Katherine Kerr im Forschungslabor Personalized Biomedical Engineering zu Gast. Im Interview berichtet die 23-Jährige von ihrem Forschungsthema, neugierigen deutschen Schüler/-innen, den Unterschieden zwischen deutschen und amerikanischen Hochschulen und Überraschungen im Alltag.
Frau Kerr, Sie haben ein Bachelorstudium in Biomedizintechnik abgeschlossen und beginnen im Juli mit Ihrer Doktorarbeit im Bereich der kardiovaskulären Biomechanik. Was mögen Sie an Ihrem Forschungsgebiet?
Schon während meiner High School-Zeit habe ich in die Forschung im Bereich Biomedical Engineering an der University of Pittsburgh hineingeschnuppert. Die Kombination aus Medizin, Ingenieurwesen und MINT gefiel mir – ich finde es faszinierend, Probleme nicht nur diagnostizieren zu können, sondern Lösungen dafür zu erarbeiten, und das gemeinsam mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen.
Nach Ihrem Bachelorabschluss haben Sie sich für ein Fulbright-Stipendium beworben. Warum ausgerechnet in Deutschland?
In der High School habe ich damit begonnen, Deutsch zu lernen. Auch an meiner Universität habe ich Deutschkurse belegt. Die deutsche Kultur spricht mich an: Sie ähnelt der amerikanischen Kultur genügend, um die Mentalität verstehen zu können, und ist doch ganz anders und deshalb spannend. Außerdem habe ich das Gefühl, dass die deutsche Kultur zu meiner Persönlichkeit passt – das Ruhige, Geregelte, Effiziente schätze ich sehr.
Und haben sich Ihre Erwartungen an das Leben in Deutschland erfüllt?
Ja, auf jeden Fall. Allerdings kann man sich vorab trotz allen Internetrecherchen nicht wirklich vorstellen, wie es sich anfühlt, in einem anderen Land zu leben. Ich habe auch noch einmal bemerkt, wie sehr man die Welt durch seine Sprache wahrnimmt. Jetzt, wo ich immer flüssiger Deutsch spreche, habe ich den Eindruck, meine Stimme zurückzugewinnen.
Lustig finde ich, wie ich deutsche Verhaltensweisen annehme – zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr: In den USA ist es normal, dass ein Bus zehn Minuten oder mehr zu spät kommt. Wenn mein Bus hier nur zwei Minuten zu spät ist, bin ich inzwischen genauso genervt wie die Deutschen um mich herum (lacht). Und es gibt hin und wieder immer noch kleine Dinge, die mich überraschen. Zum Beispiel, wie viel in Deutschland mit Bargeld bezahlt wird, wie wenige Bildschirme es an öffentlichen Wänden gibt oder wie funktional deutsche Fenster im Vergleich zu amerikanischen Fenstern sind.
Womit beschäftigen Sie sich an der Frankfurt UAS?
Ich arbeite mit im Projekt zur individuellen Rupturrisikoanalyse von Bauchaortenaneurysmen. Dabei geht es darum, nicht-invasiv zu prüfen, welchen Zustand die Wand eines Aneurysmas, also einer Aortenausbuchtung, hat und wie hoch das Risiko ist, dass diese Wand reißt – man spricht von einer Ruptur. Nur, wenn solch ein Risiko gegeben ist, sollte operiert werden. Andernfalls kann die OP selbst eine Gefahr für die Patientin oder den Patienten darstellen. Für unsere Forschung nutzen wir 4D-Ultraschalldaten, also 3D-Daten, die um eine zeitliche Dimension ergänzt werden. So können wir die Bewegung der Aortenwände nachvollziehen.
In diesem Projekt untersuche ich Patientendaten von unseren klinischen Partnern und erstelle dabei Modelle, die es ermöglichen, Befunde von Menschen mit Aneurysmen, gesunden Menschen und Menschen mit anderen Krankheiten zu vergleichen. Auf diese Weise möchte ich Aussagen über das Risiko einer Bauchaortenaneurysmen-Ruptur bei Patientinnen und Patienten verschiedener Altersgruppen und Gesundheitszustände treffen. Es ist toll, Teil eines Projektes sein zu können, das Menschen nachhaltig hilft. Meine Ergebnisse möchte ich, wenn alles klappt, im Juli beim Kongress der European Society of Biomechanics in Maastricht vorstellen und anschließend publizieren.
Sie arbeiten nun schon seit dem frühen Herbst im Forschungslabor. Welche Unterschiede zwischen dem amerikanischen und dem deutschen Hochschulleben nehmen Sie wahr?
Studierende in den USA zahlen sehr hohe Studiengebühren, deshalb verfügen die Unis natürlich über ganz andere finanzielle Mittel als in Deutschland. Dafür kann man an deutschen Unis und Hochschulen ohne Gebühren studieren. Ein grundlegender Unterschied zwischen beiden Ländern spiegelt sich auch an den Hochschulen: An amerikanischen Unis ist, wie so oft in den USA, viel Platz und es wohnen viel mehr Studierende direkt auf dem Campus. Die Hochschule ist wie eine eigene kleine Stadt. Deutsche Hochschulen scheinen kompakter zu sein, die Wege sind kürzer. Gleichzeitig ist Sport in Amerika viel präsenter im Unilalltag. Es ist ganz üblich, dass Studierende mit Freunden zu Fußball- oder Basketballspielen der Hochschulmannschaften gehen.
Teil Ihres Stipendienaufenthalts sind Schulbesuche im Rahmen des Programms „Meet U.S.“, das die amerikanische Botschaft organisiert. Wie erleben Sie die deutschen Schülerinnen und Schüler?
Als unglaublich neugierig! (lacht) Die Schülerinnen und Schüler wollen alles wissen – ihre Fragen reichen von der nach meinem Lieblingsrapper zur Frage, was ich eigentlich vom Zwei-Parteien-System in den USA halte. Es geht sehr viel darum, wie Deutsche und Amerikaner einander wahrnehmen. Diese Schulbesuche machen wirklich Spaß und ich wünschte, solche kulturellen Austauschprogramme wären auch in den USA viel etablierter. Ein Treffen mit einem echten Menschen aus einer fremden Kultur lässt sich einfach durch kein Youtube-Video und keinen Schulbuchtext ersetzen.
Was möchten Sie noch sehen, bevor Ihr Aufenthalt in Deutschland endet?
Berlin, Hamburg und München stehen noch auf meiner Liste, außerdem würde ich sehr gerne nach Schottland fliegen und mir die Stadt Edinburgh anschauen. Hier in Deutschland und Europa ist alles so nah beieinander – ich möchte noch so viel reisen, wie ich kann.
Mehr Informationen zum Forschungslabor Personalized Biomedical Engineering:www.frankfurt-university.de/pbe
Mehr Informationen zum Fulbright-Programm:www.fulbright.de